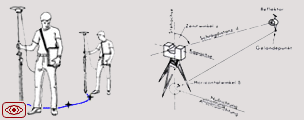
gewährleistet werden kann (Wald, Häuserschluchten, etc.), werden bei einigen Anwendungen verstärkt hybride Messverfahren (Kombination verschiedener Messsensoren) eingesetzt. Zudem erfolgt eine ständige technische Weiterentwicklung der GPS- Empfänger und Tachymeter. Als Beispiel sei an dieser Stelle die reflektorlose Distanzmessung mit elektro- nischen Tachymetern genannt. Durch Einsatz dieses Messverfahrens ist es möglich auch nicht zugängliche Objekte schnell und präzise aufzumessen.
Auch mit photogrammetrischen Messverfahren lassen sich räumliche Objekte berührungslos vermessen. Der Messvorgang ist bei diesem Verfahren allerdings in zwei zeitlich getrennte Arbeitsschritte aufgeteilt. Im